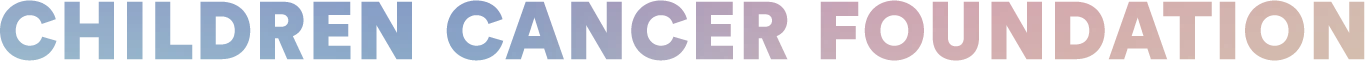Text von Melanie Steiger
Krebs tritt bei Kindern und Jugendlichen eher selten auf, trotzdem ist es die zweithäufigste Todesursache. Die CCF Children Cancer Foundation unterstützt seit 1997 krebskranke Kinder und Jugendliche in Liechtenstein. Seit Beginn des Jahres arbeitet Fabienne Lemaire für die Stiftung.
Frau Lemaire, wie sind Sie zur Stiftung CCF gestossen?
Das Thema Wohltätigkeit begleitet mich in meiner Freizeit schon lange, sei es bei meiner ehemaligen Tätigkeit im Frauenhaus, bei Pink Ribbon oder der Krebshilfe Liechtenstein. Als ich mich nach einer Weiterbildung beruflich verändern wollte, erhielt ich ein Angebot der CCF, bei dem ich meine private Leidenschaft in den Beruf integrieren konnte und das ist genial. Die CCF gibt es zwar schon seit 1997, dennoch ist sie kaum bekannt. Ich freue mich, dies zu ändern. Denn es ist ein wichtiges Thema.
Kinderkrebs ist ein hartes Thema, wie gehen Sie damit um?
Es ist schwer, keine Frage. Aber nur weil es schmerzhaft ist, dürfen wir nicht darüber schweigen. Kinderkrebs gibt es, auch wenn man nicht darüber spricht. Und gerade dann brauchen betroffene Familien Unterstützung von dem Teil der Gesellschaft, der nicht betroffen ist.
Inwiefern bekommen Sie die Schicksale der Familien mit?
Wir arbeiten eng mit den Sozialarbeitenden der Kinderspitäler zusammen und erfahren so direkt, wo Familien Unterstützung brauchen. Durch die Anträge, die bei uns eingehen, lernen wir ihre Schicksale kennen. Meine Aufgabe ist es, zu schauen, welche Bedürfnisse sie haben und wie wir ihnen am besten helfen können.
Geht es dabei um das Finanzielle?
Ja. Die Stiftung unterstützt in erster Linie finanziell benachteiligte Familien, die sich in einem Engpass befinden. Wir übernehmen Selbstbehalte, Zusatzkosten und Lohnausfälle. Denn meist ist es ein langwieriger Weg, bis ein Kind geheilt ist.
Warum ist Lohnersatz so wichtig?
Ein krebskrankes Kind braucht intensive Betreuung im Spital, da ist es oft kaum möglich, weiterhin normal zu arbeiten. Viele Eltern reduzieren ihr Pensum oder geben den Beruf vorübergehend auf. Dadurch entsteht meist eine grosse finanzielle Lücke, zusätzlich zur grossen Sorge um das kranke Kind. Wir versuchen zumindest die finanzielle Belastung zu lindern.
Welches sind weitere typische Kosten, die die Stiftung übernimmt?
Wir haben beispielsweise eine Familie unterstützt, die mit ihrem palliativen Kind noch einen letzten gemeinsamen Urlaub verbringen wollte. Sieht man danach die berührenden Fotos, weiss man, weshalb man morgens aufsteht und arbeiten geht. Häufig übernehmen wir Fahrkosten, Verpflegungs- und Unterbringungskosten. Das Zentrum für Protonentherapie befindet sich beispielsweise im Aargau. Familien aus der ganzen Schweiz müssen mit ihren Kindern für die ambulante Bestrahlung dorthin reisen. Die Kinder sind nach der Behandlung geschwächt, oft ist ein mehrwöchiger Aufenthalt in einem Hotel oder Zimmer nötig. Das verursacht hohe Kosten, die die Krankenkasse nicht übernimmt.
Fällt es den Familien leicht, Unterstützung anzunehmen?
Es ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt tatsächlich auch Familien, die sich gar keine finanzielle Hilfe holen, weil sie sich schämen. Sie wollen es selbst stemmen und es ist ihnen wichtig, es aus eigener Kraft zu schaffen. Andere wollen nur einen Teil des Betrags, damit sie auch einen Teil beitragen können.
Was geht in Ihnen vor, wenn Sie von den schwierigen Geschichten erfahren?
Als Mutter kann ich mir vorstellen, dass eine Krebserkrankung eines Kindes wohl das schlimmste ist, was einer Familie passieren kann. So etwas hat niemand in der Hand. Aber man darf nicht vergessen, dass 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen den Krebs überleben. Die Medizin hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass das Kind gesund ist. 80 Prozent der geheilten Kinder leiden Jahre später an Spätfolgen, die sie ein Leben lang begleiten.
Was sind die Spätfolgen?
Mit einer regelmässigen Nachsorge können Spätfolgen frühzeitig erkannt und behandelt werden. So unterschiedlich wie die Erkrankungen sind, sind auch die Spätfolgen. Es können die inneren Organe, der Hormonhaushalt, die Fruchtbarkeit oder die kognitive Leistungsfähigkeit betroffen sein, um nur einige zu nennen.
An welchen Krebsarten erkranken die Kinder und Jugendlichen?
Ganz vorne sind mit 30 Prozent Leukämien, gefolgt von Tumoren vom zentralen Nervensystem mit 24 Prozent und 12 Prozent sind Lymphome. In der Schweiz erkranken pro Jahr 350 Kinder und Jugendliche an Krebs.
Was ist mit den Geschwistern?
Die leiden mit. Sie sorgen sich genauso und müssen oft einfach zurückstecken, weil die ganze Familie das kranke Kind betreut. Das ist sehr belastend.
Hat sich Ihr Blick auf das Leben verändert?
Bereits während meiner Tätigkeit bei Pink Ribbon und der Krebshilfe war ich mit schwierigen Themen konfrontiert. Zwei gute Freundinnen und meine Patentante sind an Brustkrebs gestorben. Das verleiht einem einen anderen Blick auf das Leben. Kinderkrebs trifft einen noch tiefer. Da wird man unglaublich dankbar, wenn die eigenen Kinder gesund sind. Gesundheit ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann. Gleichzeitig denkt man mehr über den eigenen Lebensstil nach: Man möchte das Leben geniessen, bewusster leben und dankbar sein, für das was man hat.